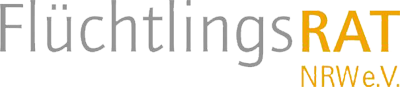| EU-Migration Urteil des LSG Hessen zu langfristigen Überbrückungsleistungen für Unionsbürger*innen rechtskräftig
Das Landessozialgericht Hessen hatte am 1. Juli 2020 geurteilt, dass die Überbrückungsleistungen regelmäßig auch über einen Monat hinaus während des gesamten tatsächlichen Aufenthalts erbracht werden müssen und dass die Äußerung eines „Ausreisewillens" hierfür nicht Voraussetzung ist. Der Verweis auf Rückreise und Bedarfsdeckung im Herkunftsland sei kein legitimer Zweck für Kürzung oder Ausschluss des menschenwürdigen Existenzminimums.
Das LSG Hessen stellt in der Entscheidung einige wichtige Grundsätze auf, die in der Auseinandersetzung mit den Sozialbehörden immer wieder umstritten sind:
- Überbrückungsleistungen sind von einem Antrag auf die reguläre Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst, sie müssen nicht gesondert beantragt werden.
- Es gilt auch bei den Überbrückungsleistungen der Kenntnisgrundsatz ohne Antragserfordernis: Sie müssen dann erbracht werden, wenn dem Sozialamt bekannt wird, dass der Bedarf besteht und nicht durch eigene Mittel gedeckt werden kann. Ein formelles Antragserfordernis gibt es für die Überbrückungsleistungen nicht. Dies gibt es nur für die Übernahme der „Rückreisekosten" gem. § 23 Abs. 3a SGB XII.
- Außer der Bedürftigkeit und dem Ausschluss von der regulären Hilfe zum Lebensunterhalt ist keine weitere Voraussetzung zu erfüllen. Insbesondere ist die Äußerung eines „Ausreisewillens" keine Voraussetzung für den Anspruch auf Überbrückungsleistungen.
- Für die gesamte Zeit des tatsächlichen Aufenthalts muss das gesamte Existenzminimum sichergestellt werden und (zumindest) Überbrückungsleistungen erbracht werden. Eine zeitliche Beschränkung auf einen Monat ist nach verfassungskonformer Auslegung unzulässig. Dafür muss die Härtefallregelung des § 23 Abs. 3 S. 6 SGB XII herangezogen werden und – entgegen dem Gesetzeswortlaut – auch bei nicht befristeten Bedarfslagen greifen: „Die Härtefallregelung muss jeden während des tatsächlichen Aufenthalts entstehenden Bedarfsfall der Leistungen nach dem Dritten und Fünften Kapitel erfassen." – also Hilfe zum Lebensunterhalt und alle notwendigen Gesundheitsleistungen.
- Aber: Alle Bedarfe, die über die in § 23 Abs. 3 Satz 5 genannten (also Ernährung, Körper-, Gesundheitspflege, Unterkunftskosten, Gesundheitsnotversorgung und Schwangerschaft) hinausgehen, müssen individuell geltend gemacht werden und die Bedarfslage tatsächlich vorliegen. Die Pauschalierung sei nicht anwendbar: „Der Unterschied zu Leistungen nach dem Dritten Kapitel besteht mithin darin, dass die bedürftige Person von dem pauschalierten Leistungsmodell des Dritten Kapitels auf die Anmeldung des individuellen Bedarfs insbesondere im Bereich der soziokulturellen Existenz verwiesen wird und im Falle der fehlenden Darlegung des Bedarfes auch nicht von der Pauschalierung profitieren kann." Die gesamten soziokulturellen Bedarfe müssen also individuell geltend gemacht werden – müssen dann aber ebenfalls erbracht werden.
- Das LSG deutet an, dass es dieses spezielle Erfordernis einer individuellen Geltendmachung soziokultureller Bedarfe ausschließlich für Personen ohne materielles Aufenthaltsrecht als zulässig ansieht, nicht aber für Personen mit Aufenthaltsrecht zur Arbeitsuche: „Insbesondere bei den Leistungsausschlüssen der § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 2. Var SGB XII und § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Var. SGB XII handelt es sich um Personen mit einem materiellen Aufenthaltsrecht, das von einem Bezug existenzsichernder Leistungen unberührt bleibt. Die dortigen Personenkreise sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Voraussetzungen erfüllen, die stets eine positive Prognose zur (Arbeitsmarkt-)Integration begründen, nämlich im Falle der Nr. 2 2. Var. die Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 Abs. 1a FreizügG/EU (vgl. dazu auch aus unionsrechtlicher Perspektive: EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts vom 12- März 2009, Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585, Vatsouras und Koupatanze, juris Rn. 51 ff., 63) oder aber aufgrund vorheriger Erwerbstätigkeit und in das Bildungssystem integrierter Kinder hier sozial integriert sind. Es wäre offensichtlich fehlsam, diesem Personenkreis einen geminderten Bedarf wegen einer bevorstehenden Ausreise zu unterstellen."
- Der Verweis auf Rückreise und Bedarfsdeckung im Herkunftsland ist kein legitimer Zweck für Kürzung oder Ausschluss des menschenwürdigen Existenzminimums: „Die bloße Heimkehrmöglichkeit bei tatsächlichem Inlandsaufenthalt ist für die Geltung des Grundrechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ohne Bedeutung."